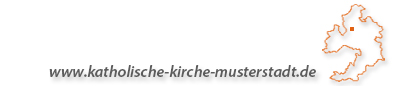Rote Rosen für tote Zwangsarbeiter – Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

„Zwangsarbeit im Nationalsozialismus – auch in Fulda. Eine Spurensuche auf dem Zentralfriedhof Fulda und an weiteren Orten“– unter diesem bewegenden Motto gedenken Schülerinnen und Schüler der Richard-Müller-Schule den Zwangsarbeitern, die während des Zweiten Weltkriegs in Fulda und Umgebung leiden mussten und auf dem Zentralfriedhof ihre letzte Ruhe fanden. In einer dreitägigen Projektarbeit setzten sich die Jugendlichen intensiv mit den Schicksalen dieser Opfer auseinander, die im nationalsozialistischen Regime als „Untermenschen“ behandelt und ohne Rechte gefangen gehalten wurden.
Das Projekt, das bereits zum dritten Mal in Kooperation zwischen der Katholischen Akademie des Bistums Fulda, der Richard-Müller-Schule und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stattfand, bot den Schülerinnen und Schülern der 12. Jahrgangsstufe einen tiefen Einblick in die Geschichte und das Leid der Zwangsarbeiter. Es war eingebettet in eine Reihe von Veranstaltungen, die an die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs erinnerten, darunter ein Akademieabend zum Thema „Todesmärsche von Zwangsarbeitern“ und ein Aktionstag zum Kriegsende am 8. Mai in Fulda.

Daniel Schrimpf, Regionalbeauftragter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, betonte in seiner Ansprache, wie wichtig es sei, die Gräber der Zwangsarbeiter als „Lernort“ zu würdigen. „Es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass hier Menschen in unwürdigster Weise behandelt wurden, aber auch darum, dass junge Menschen heute Haltung zeigen, wo die Würde eines Menschen verletzt wird“, sagte er. Die Schüler der Richard-Müller-Schule tauchten tief in die Geschichte der Zwangsarbeit ein und erfuhren, dass viele der Verstorbenen, die heute auf dem Fuldaer Zentralfriedhof begraben sind, im Alter von nicht mehr als 20 Jahren in die Arbeitslager verschleppt wurden – oft aus Polen und den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. Zu Beginn war die Arbeit noch freiwillig, doch schon bald wurden den Arbeiter:innen die Pässe abgenommen und die Rückkehr in ihre Heimat verhindert.
Die Schüler:innen beschäftigten sich mit der Situation von Zwangsarbeitern in Fulda, die vor allem in großen Fabriken wie Mehler, dem Emaillierwerk und den Gummiwerken arbeiten mussten. In den Gummiwerken beispielsweise waren 1943 von etwa 1200 Beschäftigten rund 750 Zwangsarbeiter. Ein Zeitzeuge, Herbert Ritz, erinnerte sich daran, dass Zwangsarbeiter in der Nachbarschaft lebten, unter extremen Bedingungen arbeiteten und ständig überwacht wurden. „Sie lebten in einem Lager außerhalb der Stadt, mussten zu Fuß zur Arbeit gehen, erhielten wenig zu essen und waren jederzeit der Gewalt der Aufseher ausgesetzt“, so Ritz. Steven Lorenz, einer der Schüler, brachte das Leid der Zwangsarbeiter auf den Punkt: „Sie wurden wie Müll entsorgt.“ Massengräber waren die Folge der systematischen Vernichtung und Entwürdigung der Zwangsarbeiter durch das Nazi-Regime. Viele der Toten wurden auf dem Fuldaer Zentralfriedhof in anonymen Gräbern bestattet, oft ohne Namen oder Lebensdaten.
Die Steinkreuze auf dem Friedhof, die heute noch das Gedenken an die Opfer bewahren, tragen häufig keine Identität der Verstorbenen. Dies wird von der Schülerin Fabienne Zentgraf und ihren Mitschüler:innen als eine Form der Entwürdigung wahrgenommen. Ihre Antwort darauf war eine symbolische Geste: Sie legten rote Rosen an die Steinkreuze, um den Toten zumindest auf diese Weise Respekt und Anerkennung zu zollen. „Es ist wichtig, dass wir uns mit der Geschichte befassen und den Opfern die Würde zurückgeben, die ihnen damals genommen wurde“, sagte Michaela Wolfschlag, Leiterin der Abteilung Berufliches Gymnasium an der Richard-Müller-Schule. Für sie ist das Projekt ein Hoffnungszeichen – ein Zeichen, dass junge Menschen nicht nur das Leid der Vergangenheit erkennen, sondern auch aktiv dazu beitragen wollen, dass sich solche Grausamkeiten nicht wiederholen.
Der evangelische Dekan Dr. Thorsten Waap und der katholische Dechant Stefan Buß erinnerten in ihren Reden an persönliche Erlebnisse von Menschen, die in Kriegszeiten trotz der allgemeinen Brutalität Menschlichkeit erfuhren. Waap erzählte von einem Freund, der als Kriegsgefangener in Frankreich in einer Bauernfamilie Aufnahme fand und dort trotz der schwierigen Umstände mit Würde behandelt wurde. Buß sprach von seinem Urgroßvater, der russische Zwangsarbeiter in seinem Friseursalon beschäftigte und dadurch zumindest einen Teil ihrer Würde wiederherstellte. Am Ende des Projektes wurde der symbolische Akt des Gedenkens – das Niederlegen der roten Rosen – von den Schüler:innen als wertvolle Erfahrung empfunden. Sie hatten nicht nur mehr über die Geschichte der Zwangsarbeiter erfahren, sondern auch darüber, wie wichtig es ist, den Opfern dieser Zeit mit Respekt zu begegnen und aus der Vergangenheit zu lernen.
Gunter Geiger, Direktor der Katholischen Akademie des Bistums Fulda, zeigte sich erfreut über die anhaltende Unterstützung der Stadt Fulda und insbesondere von Frau Christina Fladung, die als Ansprechpartnerin der Friedhofsverwaltung einen wichtigen Beitrag zu diesem Projekt geleistet hat. „Es ist nicht nur ein Projekt des Gedenkens, sondern auch der Erinnerung und der Auseinandersetzung mit unserer Geschichte“, so Geiger. Das Projekt ist ein wichtiger Beitrag zur lebendigen Erinnerungskultur in Fulda und darüber hinaus. Es erinnert uns daran, dass es unsere Verantwortung ist, die Geschichten der Opfer zu bewahren und aus der Vergangenheit die nötigen Lehren zu ziehen, um eine gerechtere und menschlichere Zukunft zu gestalten.


















Katholische Akademie des Bistums Fulda
Neuenberger Str. 3-5
36041 Fulda
Telefon: 0661 / 8398 - 0



© Katholische Akademie des Bistums Fulda
Katholische Akademie des Bistums Fulda
Neuenberger Str. 3-5
36041 Fulda




© Katholische Akademie des Bistums Fulda